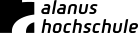Die offene Gesellschaft beruht auf der Annahme, dass sich im Wettstreit der Meinungen das geeignetere Konzept durchsetzt, weil es die klügere Lösung verspricht. Im politischen Streit geht es allerdings im Unterschied zur Wissenschaft nicht stets um wahr und falsch, sondern eher um richtig und falsch, wie Erhard Eppler, erfahrener Politiker mit sprachkritischem Engagement, einmal zusammengefasst hat. Selbstverständlich muss und soll sich der Meinungsstreit auch um Nachweisbarkeit seiner Thesen bemühen, aber das politisch Praktikable, Machbare bleibt Messlatte der vorgetragenen Vorschläge. Auch in unserer wissenschaftsbasierten Gesellschaft kommen in der Sphäre des Politischen weitere Aspekte hinzu: Interessen, Milieus, politische Heimaten.
Die Grundlage der öffentlichen Debatte bildet das hohe Gut der Meinungsfreiheit, das grundgesetzlich geschützt und bewehrt ist. Der Gesetzgeber vertraut darauf, dass damit im Großen und Ganzen vernünftig umgegangen wird. Grenzverletzenden Tatbeständen wie z.B. Beleidigung, Volksverhetzung oder Aufforderung zu strafbaren Taten werden rechtliche Grenzen gesetzt. Der zunächst umstrittene erste Beschluss des Landgerichts Berlin zum Künast-Fall hat allerdings gezeigt, wie weit der gesetzliche Schutz der Meinungsfreiheit gelegentlich ausgelegt werden kann. Im alltäglichen Geschehen sind wir in der offenen Gesellschaft letztlich aber selbst gefordert, das Spektrum des Sagbaren im Dialog der Freien miteinander auszuhandeln, denn nicht alles kann rechtsrelevant sein. Die politische Sprachgemeinschaft muss am Ende selbst den Rahmen setzen, innerhalb dessen sie im Konzert der Stimmen aufeinander reagiert.
Empathische Sprache?
In diesem Zusammenhang ist es erhellend, zwei Stimmbeispiele zu hören. Das eine Beispiel ist Robert Habecks Buch „Wer wir sein könnten. Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht“ . Das andere Beispiel ist das Rezo-Video „Zerstörung der CDU“. Zunächst zu Habecks Buch: Habeck, ähnlich wie Erhard Eppler erfahrener Politiker und Philologe, reflektiert über das große Thema der politischen Sprachkultur. Er diagnostiziert besorgt sprachliche Grenzverschiebungen und erinnert daran, dass es dabei nicht nur um Schall und Rauch geht, sondern dass die Sprache bzw. der Sprachgebrauch uns ausmacht: „Wie wir sprechen, entscheidet darüber, wer wir sind.“
Wörter, gerade politische oder politisch aufgeladene Begriffe, schaffen auch Wirklichkeit und häufig Einseitigkeiten. Habeck empfiehlt uns eine „Sprache, die auch Alternativen zulässt“. Gewiss, er will die Dinge (auch aus seiner Sicht) beim Namen genannt sehen, wie zum Beispiel „Klimakrise“ statt „Klimawandel“. Aber er plädiert auch dafür, zu akzeptieren, dass das demokratische Geschehen aus dem Ausgleich der Interessen und der Herstellung eines Konsenses besteht. Es versteht sich, dass Habeck am Gegenpol zur offenen, also nicht abgeschlossenen Sprache solche Begriffe geißelt, die stigmatisieren und dadurch „Gewalt normalisieren, Empathie betäuben, Gefühlskälte schaffen“. Habeck wendet sich damit letztlich gegen politische Vorstellungen einer widerspruchsfreien Homogenität: Stattdessen will er „das andere bestehen lassen, so wie es ist und wie es wird, es nicht in eine Form, einen Mythos, eine Identität zwingen – das ist der Unterschied zur Gleichmacherei, die den Menschen zum Gegenstand macht (…)“.
Habeck fordert dagegen eine „Sprache und Kultur der Anerkennung“ anderer. Nicht also Einheit im Sinne von Ähnlichkeit ist das Ziel, sondern das Schaffen des Gemeinsamen aus der unaufhebbaren Vielfalt. Sprachlich zeigt sich diese Zielsetzung im Ideal eines empathischen Sprachgebrauchs, der politischen Korrektheit. Ein hoher Anspruch! Aber Habeck weiß auch: Alles ist politisch aufgeladen, und so fragt er mit einem Anflug von Ratlosigkeit: „Wie also weitersprechen?“ Und so lautet der Suchauftrag: „eine Sprache zu finden, die grundsätzlich offen ist, die ein Gespräch ermöglicht, die übersetzt, die einlädt, die offen ist für Neues und anderes“. Eine Utopie, zumal Habeck selbst einräumt, dass nach wie vor der Kampf um Begriffe die Gesellschaft spaltet und dass es wegen der allgemeinen Beschleunigung für viele immer schwieriger wird, ihre Weltsicht auszudrücken – eine der Ursachen des „Wutbürgertums“, dem die Anerkennung seiner Sorgen fehle. In der anerkennenden, suchenden, offenen Sprache aber sieht Habeck den „Schlüssel (…) für die politische Praxis der Gegenwart“. Gegenargumente und Widersprüche anerkennen und eigene Zweifel einräumen können – so lautet die Vorstellung vom „verstehenden Reden“.
Das Rezo-Video
Wie aber kann das gehen in der Härte der politischen Auseinandersetzung? Und muss Härte nicht auch sein? Müssen nicht auch gegensätzliche Positionen klar benannt werden? Hier zeigt uns ein anderes Beispiel einen neuen Stil sprachlich-medialer Auseinandersetzung: das Rezo-Video „Zerstörung der CDU“. Zig Millionen Klicks aus dem Stand zeugen davon, dass sich hier eine neue Stimme tatsächlich großes Gehör in der Öffentlichkeit verschafft. Einem jungen Youtuber ist es gelungen, ein politisches Feuerwerk abzuziehen, das den politischen Gegner praktisch sprachlos ließ. Eine Woche vor der Europawahl 2019 wurde das 55-Minuten-Video veröffentlicht.
Seine Gliederung? Klassisch: Ein Exordium mit der Ankündigung der Themen (soziale Gerechtigkeit, Bildung, Klima, Militär), dann die systematische Abarbeitung der Argumentation mit abschließender Conclusion. Dazwischen allerdings wenig vom Üblichen: eine Philippika, vorgetragen im Stakkato, mit kurzen Schnitten; im Hintergrund eine eher private Innenarchitektur mit Keyboards und akustischen Gitarren; musikalische Einsprengsel als Untermalung, mal harmonisch, mal dramatisch; ständig eingeblendete Angaben über Belege und Quellen, ähnlich einer visuellen Bachelorarbeit. Ganz anders aber als eine Bachelorarbeit oder eine klassische politische Rede: die Sprache. Sie bricht aus üblicher politischer Rede aus.
Aussagen, Kritik und verbale Attacken werden durch emotionale Kommentare gesteigert. Beliebt ist die Steigerungspartikel fucking im Sinne von besonders, aber mit dem jugendsprachlichen Stilzusatz von Vulgarität und Normverletzung: fucking langweilig, fucking viele Belege, keine fucking einzige. Auch als Adjektiv findet fucking Verwendung: fucking Bundestag, fucking Außenminister. Aus dem Reich des Tierlebens stammt das jugendsprachlich beliebte intensivierende Präfix sau-: sauviele Verbände, sauviele Leute. Auch aus dem fäkalsprachigen Angebot, hier überwiegend deutschsprachiger Provenienz, speist sich die Expressivität der Rede: So ganz Kacke wird’s nicht laufen; verkacken wir grad hart; kein kleiner Verkacker, junge Leute finden Eure Politik Scheiße. Jugendsprachliche Ausrufe des Kopfschüttelns und der Empörung rhythmisieren die Rede an vielen Stellen: Fuck, ist das heftig!, aber ey!; really; krass; funny, echt weird; nice (ironisch); Bullshit; inkompetenter Shit. Handelnde Politiker sind Dullis, Dudes oder auch die Muddi.
Auch umgangssprachliche Redewendungen dienen als Kommentar: nö, ham wer keinen Bock drauf; klingt doch ganz geil; das war jetzt `n ziemlicher Downer, ergänzt durch ein drastisches sonst sind wir praktisch gefickt. Neudeutsche Fragen wie hä? oder ironische Ausrufe wie yippieh! oder hupsi! erweitern das expressive Tableau, das durch Invektiven im Kleid rhetorischer Fragen komplettiert wird: Haben die Eier? Hat die Lack gesoffen?
Das alles klingt recht derb und vulgär, verfehlt aber nicht seinen Zweck: sich als echte und ehrliche Stimme jugendlicher Empörung zu vermitteln. In der Verbindung von konkreter politischer Kritik, zahlreichen Quellennachweisen, stakkato-artiger Sprechgeschwindigkeit und Jugendsprache mit der ihr eigenen Respektlosigkeit entsteht eine neuartige Wucht, die nicht zuletzt des Themas wegen gerechtfertigt zu sein scheint: eben als unverstellt, als eine authentische Stimme, die die herkömmliche Sprache der Politik aufmischt. Wie nennt es Rezo? Real talk.
Ähnlich wie Fridays for Future beruft sich Rezo an vielen Stellen auf Erkenntnisse und Beweise der Wissenschaft. Diese, so die grundlegende Topik der Rede, werden aus Gründen der Inkompetenz oder Verantwortungslosigkeit der Unionspolitiker – auch die SPD wird bedacht – nicht beachtet. Das müsse gesagt sein, bevor es abschließend hippiemäßig heißt: „Peace, ich bin raus.“ Originell ist die Verknüpfung wissenschaftlicher Quellen mit sprachlicher Vulgarität. Denn die Sprache der Wissenschaften steht dem vulgär-expressiven Sprachgebrauch diametral entgegen. Über die Validität der Quellen aus dem Rezo-Video gibt es unterschiedliche Reaktionen. In ihrem Antwortpapier räumt die CDU durchaus die Korrektheit einer Reihe von Zahlen, Daten und Quellen ein, widerspricht aber auch der Darstellung und Interpretation einer Reihe anderer. Soweit, so strittig.
Zentral scheint mir aber die Frage der sprachlichen Form des Rezo-Videos. Ihre Wucht speist sich aus der Jugendsprache. Das verleiht ihr Authentizität und damit die Glaubwürdigkeit echter Empörung. Die Frage aber ist: Können Authentizität und Emotion komplexes politisches Aushandeln ersetzen? Sind sie ihm gar überlegen? Wird hier nicht die Illusion geweckt, allein schon durch „real talk“ zu den wahren Problemen und ihrer unmittelbaren Lösung vorzudringen? Und ist dies nicht eine Kurzschlussillusion? Zur Erklärung: „Kurzschlussillusionen“, so Christian Bermes in einem luziden Beitrag, „liegen vor, wenn Unmittelbarkeit suggeriert (..) wird, jedoch nur Vermittlung zum Ziel führt.“ Die politische Sprache verliere, so Bermes, die Selbstverständlichkeit der Vermittlung, „weil Direktheit, Authentizität oder Unmittelbarkeit zum Prinzip erhoben werden“.
Christlich-humanistische Werte als Brücke?
Gibt es eine Brücke zwischen Habecks Utopie einer offenen, fragenden politischen Sprache der Politik und der Philippika von Rezo? Habecks Vorstellungen von einer empathischen, vermittelnden Sprachkultur scheint Generationen entfernt. Aber ist die Grobheit des Rezo-Videos unter dem Begriff allgemeiner Verrohung zu subsummieren? „Unsere Jugend ist ohne Zweifel unerträglich, sprachlich rücksichtslos und altklug“, klagte schon Hesiod, und das war 700 Jahre vor Christus. Will man beklagen, dass sich junge Stimmen heute wieder in die zentralen Fragen der Zeit einschalten? „Eine Generation meldet sich zu Wort“, lautet der Titel der Shell-Jugendstudie 2019. Vielleicht müssen, wie Habeck es empfiehlt, die Älteren ähnlich wie 1968 erst einmal genau hinhören.
Denn siehe da: Am Ende seines Videos und nach einer Abgrenzung der „Jungen“ von „den Rentnern“ wirbt Rezo dann schließlich doch – unterlegt von schöner Musik - um die Älteren: um Eltern und Großeltern in ihrer Verantwortung für Enkel und Urenkel, und dies sogar im Sinne „christlicher und humanistischer Werte“.
Lässt sich da nicht doch schemenhaft eine Brücke erkennen?